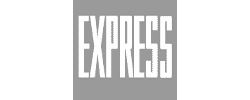Eventim darf seine Nutzer beim Ticketkauf nicht durch eine bestimmte Gestaltung zum Abschluss einer Versicherung drängen. Das hat das OLG Bamberg entschieden. In dem Verfahren ging es um die Frage, ob ein Pop-up-Fenster mit der Formulierung „Ich trage das volle Risiko“ unzulässig in die Entscheidungsfreiheit von Kunden eingreift. Das Urteil zeigt, dass „Dark Patterns“ auch immer weiter in den Fokus der Rechtsprechung rücken.

Die Gestaltung digitaler Verkaufsprozesse kann rechtliche Grenzen haben. In einem Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Bamberg wurde entschieden, dass Eventim beim Online-Ticketverkauf die Nutzer durch ein Pop-up-Fenster mit der Formulierung „Ich trage das volle Risiko“ unzulässig beeinflusst habe. Eventim darf Nutzer nach Überzeugung des OLG Bamberg nicht mit manipulativen Designs zur Ticketversicherung drängen, da dies die Entscheidungsfreiheit unzulässig beeinflusse und verbotene Dark Patterns gemäß Art. 25 DSA darstelle. Die Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) hatte damit teilweise Erfolg (OLG Bamberg, 05.02.2025, Az. 3 UKI 11/24 e).
Der Rechtsstreit zwischen dem vzbv und der CTS Eventim AG & Co. KGaA betrifft ein Detail im digitalen Verkaufsprozess, das rechtlich bedeutsam ist: die Gestaltung eines Versicherungshinweises. Wer auf eventim.de ein Ticket kaufen wollte, bekam neben dem eigentlichen Produkt die Möglichkeit angeboten, eine kostenpflichtige Ticketversicherung abzuschließen. Die Art, wie diese Option präsentiert wurde, hat nun zu einem Urteil geführt, das für viele digitale Anbieter von Relevanz sein dürfte.
Gestaltung der Ticketversicherung bei Eventim
Im Zentrum des Rechtsstreits stand die Frage, ob die Plattform Eventim beim Verkauf von Tickets eine bestimmte Versicherung auf eine Art und Weise beworben hatte, die als manipulativ gelten kann. Der vzbv hatte Klage eingereicht. Er sah in der Art und Weise, wie Eventim eine kostenpflichtige Ticketversicherung beim Online-Ticketkauf präsentierte, eine unzulässige Beeinflussung.
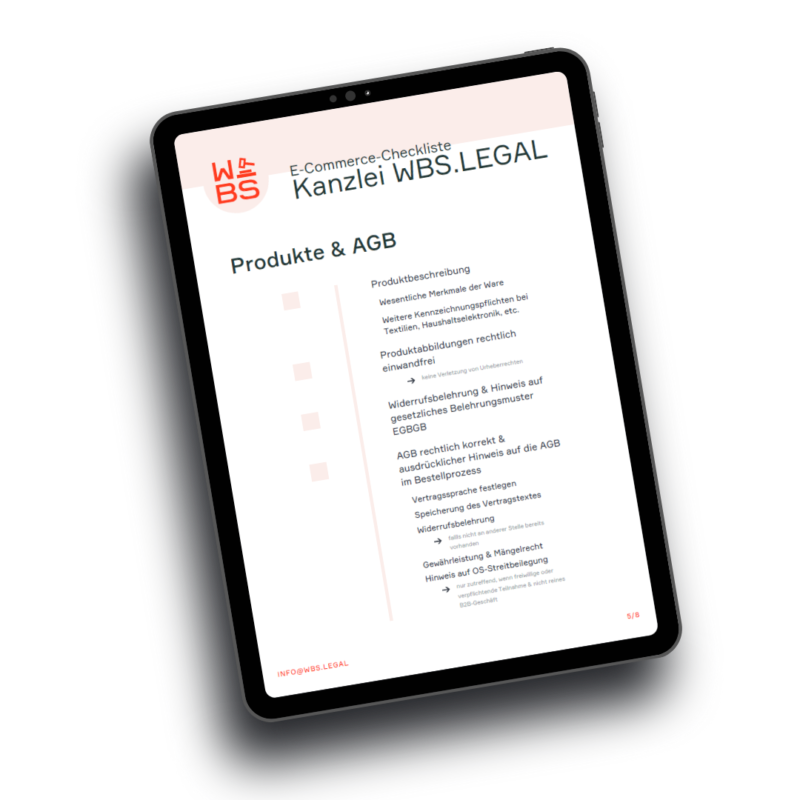
E-Commerce-Checkliste zum Download: Sorgenfrei & rechtssicher verkaufen!
Von Produktdetails bis Datenschutz: Unsere kostenlose E-Commerce-Checkliste stellt sicher, dass Ihr Online-Shop alle rechtlichen Anforderungen erfüllt. Wir schicken Ihnen die Checkliste zum Download kostenlos zu:
Es ging konkret um die Darstellung im digitalen Bestellprozess. Verbraucher, die über die Webseite Tickets kaufen wollten, konnten dabei eine Ticketversicherung hinzubuchen. Schon im Warenkorb wurde dieses Angebot deutlich sichtbar gemacht, farblich hervorgehoben und zentral auf der Seite platziert. Wer sich jedoch dazu entschied, keine Versicherung auszuwählen und stattdessen auf den Button „Weiter zur Kasse“ klickte, wurde nicht unmittelbar zur Bezahlseite weitergeleitet. Stattdessen öffnete sich ein weiteres Fenster. In diesem Fenster wurde erneut auf die Möglichkeit hingewiesen, eine Versicherung abzuschließen. Zwei Auswahlmöglichkeiten wurden dargestellt: ein farblich hervorgehobener Button für den Abschluss der Versicherung und ein weiterer Button mit dem Text „Ich trage das volle Risiko“. Erst durch Anklicken dieser zweiten Schaltfläche konnte der Bestellvorgang ohne Versicherung fortgesetzt werden.


Die Verbraucherschützer hielten diese Gestaltung für unzulässig. Sie argumentierten, dass durch die Kombination aus visueller Gestaltung, wiederholter Nachfrage und insbesondere durch die Wortwahl beim Ablehnungs-Button eine unangemessene Einflussnahme stattfinde. Die Gestaltung erwecke den Eindruck, dass der Nutzer ein erhebliches Risiko eingehe, wenn er die Versicherung nicht wähle. Dies könne dazu führen, dass sich Kunden nicht mehr frei entscheiden, sondern aus Angst oder Unsicherheit zum Abschluss der Versicherung gedrängt würden. Die Verbraucherzentrale beantragte daher, Eventim solle sowohl das erste Angebot der Versicherung im Warenkorb als auch die nachgelagerte erneute Abfrage im Pop-up-Fenster unterlassen.
Gerichtliche Bewertung manipulativer Designmuster
Das OLG Bamberg prüfte den Fall nun umfassend. Es beurteilte zunächst, ob das Verhalten von Eventim überhaupt unter die Vorschriften des Digital Services Act (DSA) falle. Die europäische Verordnung verbietet es Anbietern, ihre Webseiten so zu gestalten, dass Nutzer durch sogenannte „Dark Patterns“ zu bestimmten Entscheidungen gedrängt werden. Die Vorschriften gelten allerdings nur, wenn keine spezielleren Regelungen der EU zum Lauterkeitsrecht greifen. In diesem Fall sei, so das Gericht, allerdings die EU-Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken vorrangig anzuwenden. Dennoch könnten die Maßstäbe des DSA bei der Auslegung dieser Richtlinie mitberücksichtigt werden. Dies gelte insbesondere für das Verbot manipulativer Gestaltungen.
Zur Information: Unter „Dark Patterns“ werden bestimmte Gestaltungen von Benutzeroberflächen auf Internetseiten verstanden. Es handelt sich um inhaltliche oder graphische Muster, die auf subtile Weise so gestaltet sind, dass sie Nutzer dazu verleiten, bestimmte Handlungen auszuführen. Diese suggerieren z.B. eine vermeintliche Knappheit oder Begehrtheit eines aufgerufenen Produkts und setzen Nutzer unter Druck. Ein bekanntes Beispiel sind z.B. Countdowns, die die vermeintliche zeitliche Befristung eines Angebots angeben. Nutzer aber dürfen über die Webseiten-Gestaltung nicht getäuscht, manipuliert oder an freien Entscheidungen behindert werden. Der Umstand, dass die Dark Patterns auch in den DSA aufgenommen wurden, verdeutlicht, dass die EU der Manipulation von Verbrauchern im Internet inzwischen besondere Aufmerksamkeit widmet.
Das erste Angebot der Ticketversicherung sei im Warenkorb zwar auffällig gestaltet. Es sei jedoch für einen durchschnittlich aufmerksamen Nutzer erkennbar gewesen, dass es sich um eine freiwillige Zusatzleistung handle. Das Angebot sei nicht so aufdringlich oder dominant gewesen, dass es eine freie Entscheidung unmöglich gemacht hätte. Deshalb sei dieser Teil der Klage unbegründet gewesen.

Anders bewertete das Gericht jedoch das nachgeschaltete Fenster, das nach dem Klick auf „Weiter zur Kasse“ erschien. Die Richter kamen zu dem Schluss, dass in der konkreten Kombination von erneutem Hinweis, visueller Hervorhebung und insbesondere der Wortwahl „Ich trage das volle Risiko“ eine unzulässige Beeinflussung liege.
Nach Ansicht des OLG könne dieser Text beim Nutzer die Vorstellung hervorrufen, dass er im Falle eines nicht stattfindenden Konzerts vollständig auf den Kosten sitzenbleibe. Das Gericht betonte, dass ein solcher Eindruck nicht der tatsächlichen Rechtslage entspreche. So habe ein Käufer unter Umständen sehr wohl Anspruch auf Rückerstattung, etwa bei einer Absage durch den Veranstalter. Durch die gewählte Formulierung werde jedoch ein gegenteiliger Eindruck vermittelt. Das könne Nutzer davon abhalten, eine freie Entscheidung zu treffen. Das Gericht sah daher eine Irreführung, die die Entscheidungsfreiheit beeinträchtige.
Das OLG wies in seiner Begründung auch darauf hin, dass die Grenze zur Unzulässigkeit nicht schon durch eine einzige Nachfrage oder eine farbliche Gestaltung überschritten werde. Es sei zulässig, Nutzer auf eine Option hinzuweisen. Erst wenn mehrere Elemente zusammenkämen, könne eine Beeinflussung vorliegen. Im Eventim-Fall sei dies jedoch geschehen. Die erneute Nachfrage nach der Versicherung, die grafische Gestaltung sowie die suggestive Formulierung zusammen seien geeignet, Druck auszuüben. Die Nutzer könnten das Gefühl entwickeln, eine falsche Entscheidung zu treffen, wenn sie die Versicherung nicht abschließen. Genau dies wolle der Gesetzgeber aber verhindern.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. In jedem Fall gibt die Entscheidung Hinweise darauf, wie Gerichte künftig mit Fragen rund um manipulative Gestaltungen im digitalen Raum umgehen werden. Sie zeigt, dass Gerichte auch bei scheinbar kleinen Details wie der Formulierung eines Buttons genau hinschauen. Unternehmen, die digitale Verkaufsplattformen betreiben, sollten daher sorgfältig prüfen, wie sie Zusatzangebote präsentieren und welche Sprache sie dabei verwenden.
Unsere Experten bei WBS.LEGAL sind immer für Sie da
Das Wettbewerbsrecht bzw. das Lauterkeitsrecht und die darauf basierende Abmahnung können ein erhebliches Risiko für die gewerblichen Tätigkeiten eines Unternehmens sein. Grundsätzlich gilt, dass diejenigen, die sich einen unlauteren Vorteil verschaffen wollen, mit der ganzen Härte des Rechts rechnen müssen. Ein Rechtsanwalt kann jedoch helfen, die Abmahnung zu verhindern und die diversen gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Der Rechtsanwalt kann das Risiko einer Abmahnung einschätzen und mithelfen das Risiko zu minimieren. Ebenso kann ein Rechtsanwalt das Wettbewerbsrecht dazu nutzen, auch andere zur Einhaltung des Rechts zu zwingen. Wenn Sie einen Rechtsanwalt für Fragen im Wettbewerbsrecht oder gewerblichen Rechtsschutz suchen, möchten wir Ihnen unsere Unterstützung anbieten. Kontaktieren Sie uns gerne jederzeit unter 0221 / 951 563 0 (Beratung bundesweit).